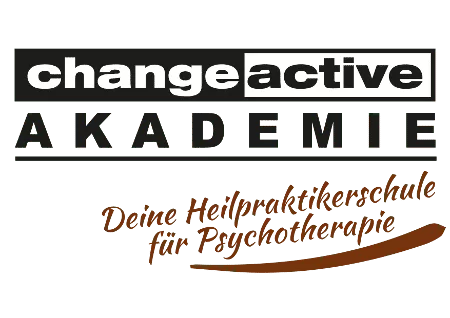Viele Menschen beginnen eine Psychotherapie mit der Frage: „Was stimmt eigentlich nicht mit mir? Wo bin ich „falsch abgebogen“? Warum gelingen meine Beziehungen nicht? Weshalb fühle ich mich ständig gestresst?
Die eigentliche, viel weitergehende Frage müsste lauten: „Bin ich überhaupt schon jemals wirklich ich selbst gewesen?“ Denn was wir oft für unser Eigenes „Selbst“ halten, ist in Wahrheit das Produkt elterlicher Erwartungen, gesellschaftlicher Normen und gut gemeinter Ratschläge. Im psychologischen Sprachgebrauch sprechen wir von „Sozialisation“. Gemeint ist hierbei der Prozess der Aneignung gesellschaftlicher Strukturen, Werte, Normen und Verhaltensmuster durch Familie, Schule, Freundeskreis. Im Weiteren auch durch gesellschaftliche Institutionen wie Religion, Vereine und auch Partnerschaften. In diesem Artikel möchte ich auf die Besonderheiten von offenen und verdeckten Aufträgen von Familie und Gesellschaft eingehen und darauf, wie diese unser Leben bestimmen, in gelingender aber auch in hinderlicher Art und Weise.
Offene und verdeckte Aufträge: Lebensskripte, die niemand unterschrieben hat
Nicht selten erhalten wir im Rahmen der eigenen Sozialisation bewusste und unbewusste „Aufträge“. Gemeint sind hierbei implizite Erwartungen von wichtigen Bezugspersonen (Eltern, Großeltern) aber auch Erwartungen, die aus der Gesellschaft an uns herangetragen werden. Diese inneren Aufträge können unser Selbstbild, unser Verhalten und auch die „Brille“, durch die wir die Welt sehen, im besonderen Maße prägen. Ein Beispiel für einen solchen Auftrag der Eltern könnte sein „Enttäusch uns nicht!“. Kinder spüren oft unausgesprochen, dass sie bestimmte Erwartungen erfüllen müssen, etwa gute Leistungen bringen oder „brav“ sein sollen, um Anerkennung zu erhalten. Ein Beispiel für einen „gesellschaftlichen Auftrag“ könnte sein „Du musst immer produktiv sein.“ Gesellschaftliche Ideale von Leistungsfähigkeit und Effizienz führen manchmal dazu, dass Menschen sich nur dann als wertvoll empfinden, wenn sie ständig etwas leisten oder umtriebig sind. Solche verdeckten Botschaften sind in der Regel keine bewusste Manipulation. Vielmehr sind sie Teil der Sozialisation und wirken wie „unterschwellige Programme“, die unser Leben steuern.
Im falschen Lebensprogramm: Äußerlich angepasst, innerlich leer
Anna kommt in die Therapie, weil sie sich „ausgelaugt, leer und irgendwie falsch“ fühlt. Nach außen scheint ihr Leben wohlgeordnet. Sie hat einen sicheren Job, führt eine langjährige Beziehung und engagiert sich in der Kirche im Ehrenamt. Doch innerlich spürt sie eine wachsende Unzufriedenheit. Sie kann kaum sagen, was sie selbst will, und ist stets nur darauf fixiert, was andere brauchen. In der Therapie beginnt sie zu reflektieren, woher diese Muster kommen und auch, in welchem Zusammenhang diese entstanden sind. Schon früh in ihrer Kindheit war Anna „die Vernünftige“. Ihre Mutter war chronisch überfordert mit der Erziehung der drei Kinder, der Vater emotional abwesend. Anna lernte: Wenn ich keine Probleme mache, wird es ruhiger. Kümmere ich mich um andere, erhalte ich die benötigte Anerkennung. Ganz offen wurde in der Familie oft ausgesprochen: „Du bist unser Sonnenschein, auf dich ist Verlass.“ Doch unausgesprochen und viel wirksamer war für Anna der verdeckte Auftrag: „Sei stark, sonst brechen wir zusammen“.
Lebensskript als veränderbares Programm?
In der Therapie erkennt Anna, wie tief dieses Lebensskript in ihr verankert ist. Sie merkt, dass ihr übermäßiges Verantwortungsgefühl für andere ein erlernter Selbstschutz ist. Der Gedanke, egoistische Bedürfnisse zu haben, macht ihr Angst. Sie fürchtet, dann nicht mehr geliebt zu werden und ihre „Daseinsberechtigung“ zu verlieren. Anna probiert für sich etwas Neues aus. Sie erlaubt sich, schwach zu sein. Zum ersten Mal in ihrem Leben sagt sie in einer Sitzung der Kirchengemeinde: „Ich schaffe das gerade nicht.“ Das war für sie ein sehr großer Schritt. Auch zu sehen, dass es für das Team kein Weltuntergang ist und auch kein Liebesentzug folgt. Im Gegenteil: Ehrliche Nähe und Authentizität entsteht. Ein kleiner, aber entscheidender Schritt für Anna auf dem Weg zu sich selbst.
Delegation: Wenn Eltern ihr (ungelebtes) Leben an die Kinder weiterreichen
Ein Mechanismus die eigene Unzulänglichkeit vor sich selbst zu verstecken, kennen wir aus der Psychoanalyse nach Sigmund Freud: die „Delegation“. Die Tochter soll zum Beispiel den beruflichen Erfolg verwirklichen, den die Mutter nie hatte. Der Sohn soll die beruflichen Träume verwirklichen, die dem Vater verwehrt waren. Jan ist 33 und Jurist. Allerdings nicht, weil er die Rechtsfächer besonders mag, sondern weil sein Vater das so wollte. In der Therapie erkennt er, dass er nie gefragt wurde, was er selbst eigentlich wollte und was ihn interessiert. Sein Leben ist eine Erfüllung fremder Träume. Sich selbst zu finden, heißt für Jan, sich das Recht zu nehmen eigene Pläne zu entwickeln und seinen persönlichen Wünschen zu folgen.
Verluste auf dem Weg der Selbstfindung? Was Therapie leisten kann
Wer sich auf den Weg zu sich selbst macht, wird unweigerlich etwas verlieren: Rollen, Illusionen, manchmal aber auch Beziehungen und Zugehörigkeit. So geht es in der Therapie nicht nur um Einsicht, es geht auch ums Loslassen, vielleicht von einem alten Selbstbild des „perfekten Kindes“, des „dauerleistenden Erwachsenen“, der netten Tochter, die alles erträgt und es immer allen recht macht. Oft fällt dieser Schritt in der Therapie am schwersten: den Mut zu haben, unbequem zu werden, Freundschaften zu beenden und Zugehörigkeiten aufzugeben, die vielleicht Sicherheit geben aber leidvoll sind.
Selbstverrat oder Selbstfindung: Meist kein Sprint sondern Marathon
Sich auf den Weg zu sich selbst zu machen ist keine Wellnessreise. Es ist ein innerer Umbau unter laufendem Betrieb, oft verbunden mit schmerzlichen Erkenntnissen und auch Abschieden. Doch mit jeder abgelegten Maske kann Raum für etwas Echtes entstehen, ohne Magenkrampf, Verbiegen und Selbstverrat. Welchen Schritt zu Dir selbst könntest Du heute gehen?
Vielleicht auch für Dich interessant:
>> Wie gelingt Heilung? Psychisch (wieder) gesund werden
>> Und du bist Schuld! Umgang mit einem bekannten Gefühl
>> Mein Klient ist konfliktsüchtig, was soll ich nur machen?