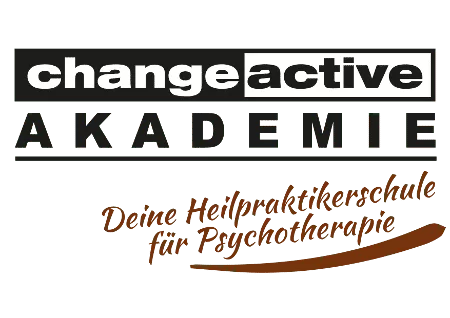„Erst wenn …“ – ich mich sicher fühle, alles genau weiß oder endlich Zeit habe. So reden wir oft, wenn wir Dinge aufschieben. Kennst Du das auch von Dir? Dahinter steckt selten Faulheit, meist sind es tiefere Gefühle, die uns bremsen. Aufschieben ist ein Teil unseres Selbstschutzes. Wir verschieben, um uns nicht überfordert zu fühlen, um uns sicherer zu glauben oder um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Kurzfristig bringt das Erleichterung, langfristig jedoch wächst der Druck.
Angst, Perfektionismus und der innere Druck: Aufschieben und seine Folgen….
Viele Menschen schieben Dinge auf, weil sie den Anspruch haben, alles perfekt zu machen. Sie wollen keinen Fehler begehen, nichts übersehen, niemanden enttäuschen. Dieser Anspruch klingt nach Stärke, entpuppt sich aber schnell als Stolperfalle: Je höher die Erwartungen an uns selbst, desto schwerer wird es, überhaupt anzufangen. Nicht selten steckt dahinter die Angst, nicht gut genug zu sein. „Was, wenn ich scheitere? Was, wenn es nicht reicht?“ Solche Gedanken können schnell im „Hintergrund“ auftauchen und uns blockieren. Gerade Aufgaben, die uns wichtig sind, fühlen sich dadurch besonders schwer an. Das Aufschieben erscheint dann wie ein Schutzschild: Solange wir nicht beginnen, können wir auch nicht versagen. Doch dieses vermeintliche Schutzmanöver hat seinen Preis. Mit der Zeit entsteht das Gefühl, nicht voranzukommen. Schuldgefühle wachsen, Selbstzweifel nehmen zu, der innere Druck steigt. Wir geraten in eine Art Stillstand. Je länger er andauert, desto schwerer erscheint der Ausstieg.
Der Kreislauf des Aufschiebens
Aufschieben ist oft ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Zunächst steht da ein Gedanke: „Ich mache es später.“ Das fühlt sich kurzfristig erleichternd an. Doch danach folgt das schlechte Gewissen. Wir wissen schließlich, dass wir die Aufgabe immer noch nicht erledigt haben. Diese Schuldgefühle erzeugen zusätzlichen Druck. Dieser wiederum macht die Aufgabe noch unangenehmer und die Hemmschwelle, sie anzugehen, steigt weiter. So entsteht ein Teufelskreis aus Vermeidung, Schuld und wachsender Belastung. Besonders tückisch: Viele wirklich wichtige Aufgaben im Leben haben keine feste Frist. Niemand zwingt uns, ein klärendes Gespräch zu führen, ein Projekt endlich anzugehen oder uns um die eigene Entwicklung zu kümmern. Ohne äußeren Druck wirken solche Vorhaben verschiebbar und landen oft ganz unten auf der inneren Liste.
Wenn Aufschieben „pathologisch“ wird: Prokrastination
Wird das Aufschieben von Wichtigem so drastisch, dass es dem Erreichen persönlicher Ziele massiv im Wege steht, sprechen wir von Prokrastination. Dahinter steckt oft eine weit reichende Unfähigkeit, mit Frustration oder unangenehmen Gefühlen (Ohnmachtsgefühle) umzugehen. Die Angst vor möglichem Versagen oder negativen Konsequenzen kann dazu führen, sich ständig ablenken zu lassen oder sich schlecht zu konzentrieren. Personen mit „Aufschieberitis“ leiden tatsächlich darunter und können Aufgaben oder Fristen oft nur mit allergrößter Mühe einhalten. Nicht selten leiden die Betroffenen unter massiver Selbstabwertung.
Wege aus der Blockade des Aufschiebens
Der Ausweg beginnt fast immer mit etwas sehr Kleinem. Nicht die großen Pläne oder perfekten Strategien bringen uns ins Handeln, sondern winzige Schritte. Fünf Minuten anfangen, eine Aufgabe in kleine Teilaufgaben zerlegen oder etwas sofort erledigen. Diese scheinbar simplen Maßnahmen durchbrechen die „alles oder nichts“-Haltung und wir machen die Erfahrung, dem Kreislauf des Aufschiebens nicht bedingungslos ausgeliefert zu sein. Entscheidend ist auch der Umgang mit uns selbst. Wer sich beim Aufschieben ständig kritisiert, verstärkt Scham und Stress. Hilfreicher ist Selbstmitgefühl: sich daran zu erinnern, dass Aufschieben kein persönliches Versagen ist, sondern ein menschliches Muster, das bei allen Menschen mehr oder weniger ausgeprägt ist. Freundlich mit sich zu sein und Fortschritte zu würdigen, zum Beispiel im Gespräch mit anderen, schafft die Grundlage, ins Tun zu kommen.
Unterstützend kann es sein, den Sinn hinter einer Aufgabe zu suchen. Sobald klar wird, warum wir etwas tun (sollen), wächst auch die Motivation es tatsächlich anzugehen. Wenn wir Vorhaben sichtbarer machen, zum Beispiel durch Aufschreiben, nimmt es Projekten die Unsichtbarkeit und macht sie realer.
Drei Tipps, Prokrastination entgegen zu wirken
Wie können wir uns selbst mit motivierenden Sätzen ins Tun bringen?
• Wenn ich den ersten Schritt wage, merke ich, dass es leichter ist als gedacht.
• Wenn ich mir eine kleine Erinnerung gebe, beginnt Veränderung.
• Wie kann ich Unterstützer*innen für mein Vorhaben gewinnen?
So wird aus dem vagen „Irgendwann“ ein konkretes „Jetzt“. Sie zeigt: Ich bin handlungsfähig, ich kann gestalten, ich bewege mich vorwärts. Wer Aufschieben versteht, erkennt: Dahinter steckt nicht Schwäche, sondern ein Versuch, mit innerem Druck umzugehen. Mit Freundlichkeit, kleinen Schritten und bewusstem Tun lässt sich dieser Versuch in echte Veränderung verwandeln. Und genau darin liegt die Chance: Nicht länger warten, bis alles perfekt ist, sondern beginnen. Mein ganz persönlicher Leitspruch: Lieber fehlerhaft begonnen, als perfekt gezögert 😊.
Das könnte Dich auch interessieren
>> Das Dopamin Dilemma: Brauchen wir den nächsten K(l)ick?
>> Sich selbst (besser) verstehen: So formen Anlage und Umwelt uns
>> Fremdbestimmt oder echt: Wer bestimmt mein Leben?